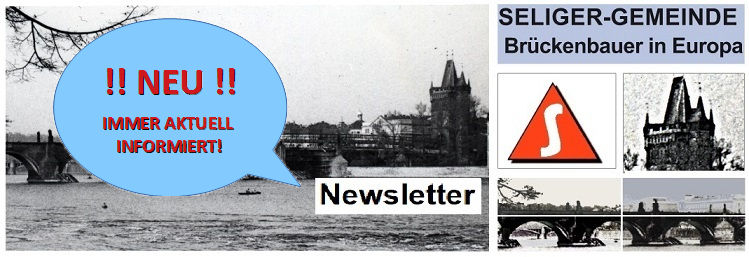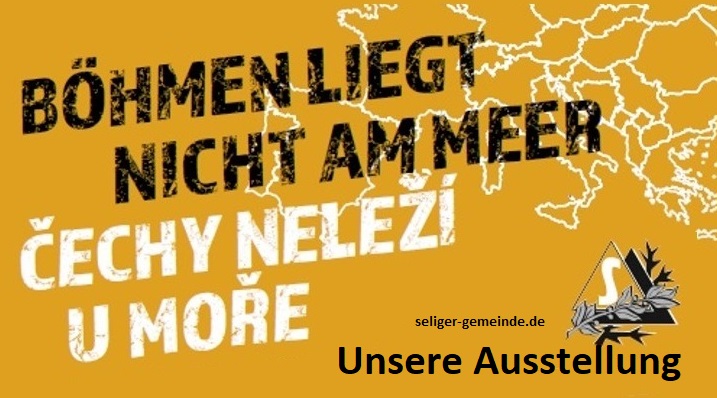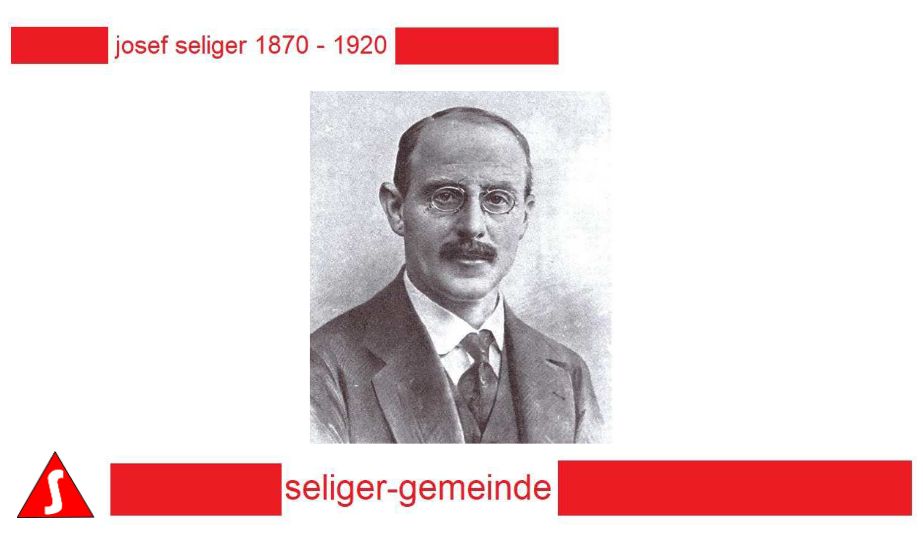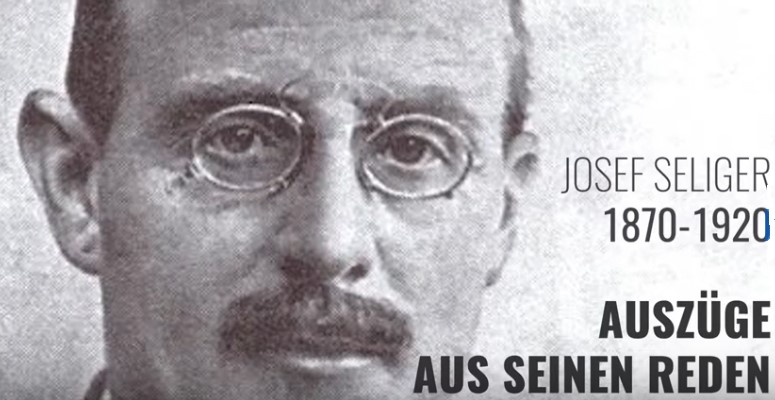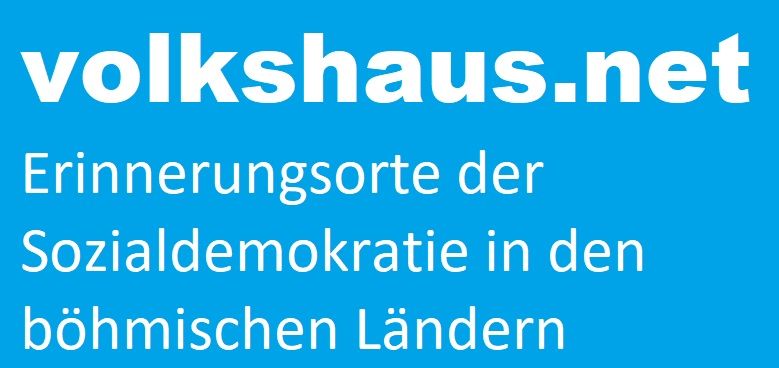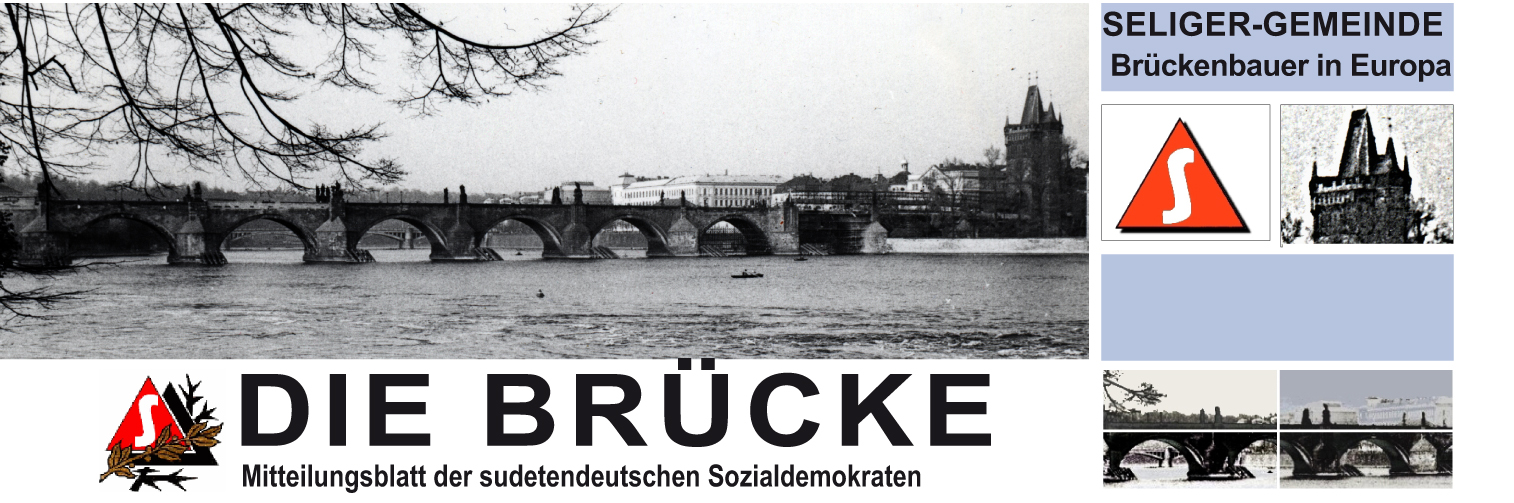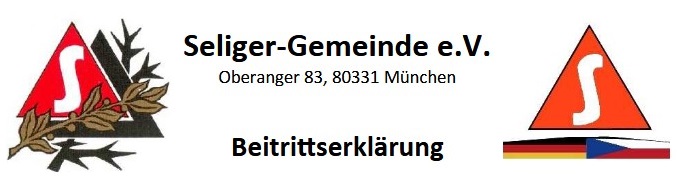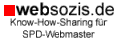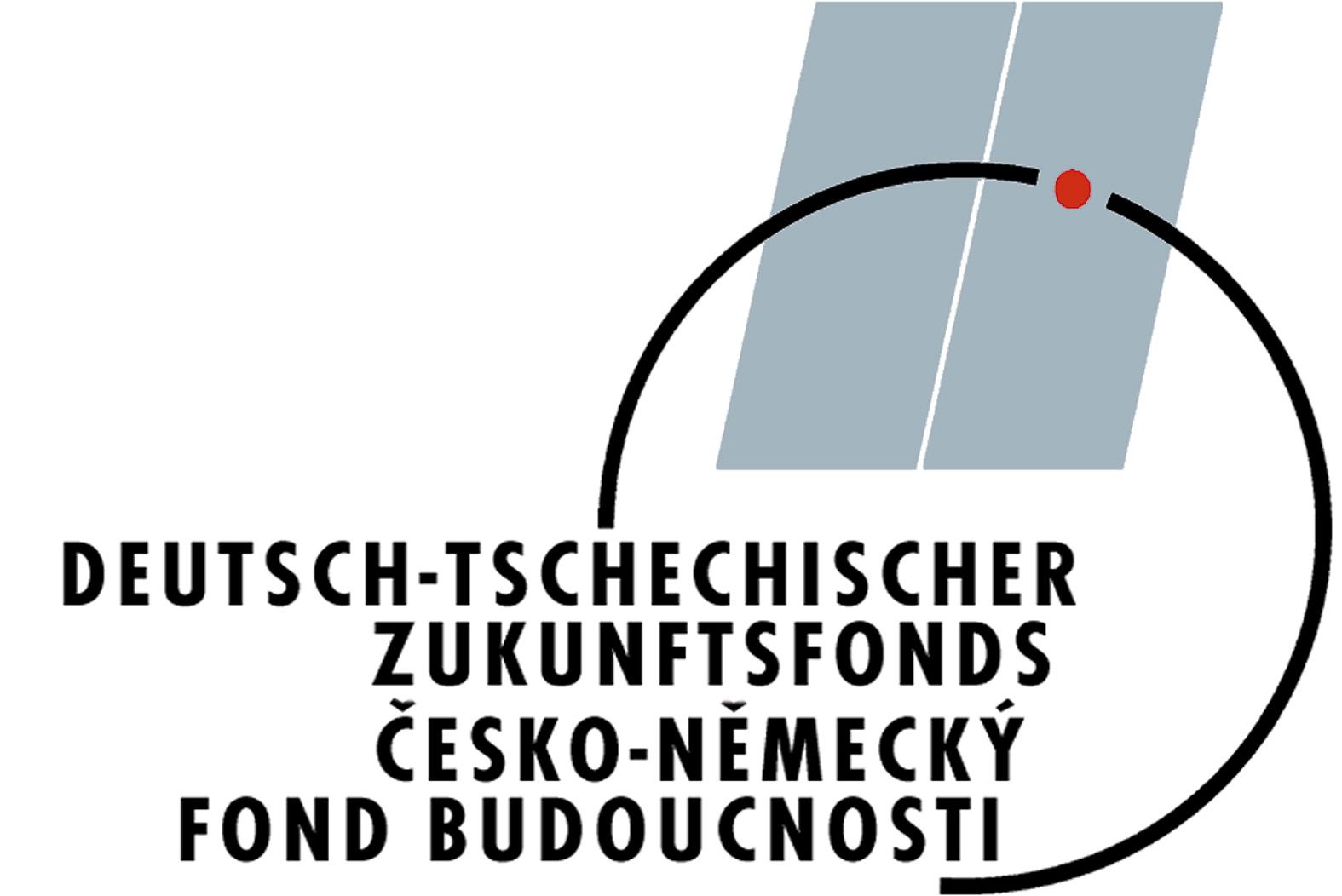„Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher Verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.“ (Heinrich Heine, 1823)
Als die Bücher brannten
Vor 85 Jahren verbrannten die Nazis Bücher und Schriften in Regensburg - brennende Bücher waren bereis 1933 mächtige Zeichen von Zensur und Bevormundung – auch sudetendeutsche Autoren betroffen
Am 10. Mai 1933 brannten die ersten Bücher in Berlin. In Regensburg fand die Bücherverbrennung am Freitag, 12. Mai 1933, auf dem Neupfarrplatz – also mitten in der Altstadt – statt. Da sich derzeit die Bücherverbrennung der Nazis zum 85. Mal jährt und dabei auch einige bekannte Werke sudetendeutscher Autoren verbrannt wurden, beschloss die Ernst und Gisela Paul-Stiftung diesen Aspekt für die kommenden Jahre als Arbeitsschwerpunkt aufzugreifen.
Binnen weniger Monate wandelte sich 1933 das einstmals als Land der Dichter und Denker beschriebene Deutschland in ein Land der Richter und Henker. Die Nationalsozialisten nahmen Kommunisten und Sozialdemokraten ins Visier. Und auch die Vordenker von Freiheit und Demokratie. Dieses Ereignis führte jedem Zeitgenossen unmissverständlich die Absicht der Nationalsozialisten vor Augen, nicht nur Andersdenkende rücksichtslos zu unterdrücken, sondern auch das kulturelle Leben mit Zensur und Bevormundung zu überziehen. Der Großteil der 1933 verbrannten Bücher stammte aus den öffentlichen Stadt- und Volksbüchereien, den privaten Leihbüchereien, aus Buchhandlungen, aus besetzten und beschlagnahmten kommunistischen, sozialdemokratischen und gewerkschaftlichen Einrichtungen und Redaktionshäusern.
Bücherverbrennung in Regensburg am 12. Mai 1933
Emil Klein (1905 bis 2010), der Beauftragte der Hitlerjugend bei der bayerischen Staatsregierung, hatte am 19. April 1933 einen Aufruf an alle Verantwortlichen der Hitlerjugend verschickt, Verbrennungen im Rahmen des „Tags der Jugend“ durchzuführen. Die Hintergründe der Vorbereitungen zur Regensburger Bücherverbrennung liegen vielfach im Dunkeln. Initiiert und durchgeführt wurde sie von der örtlichen Hitlerjugend. Zwar war einer Bücherverbrennung von Seiten der Studentenschaft in der Domstadt eine Absage erteilt worden, das in hoher Auflage im Reichsgebiet verbreitete Plakat „Wider den undeutschen Geist“ wurde in Regensburg aber öffentlich angebracht.
Die seit März 1933 erscheinende Bayerische Ostwacht, das örtliche Organ der Nationalsozialisten berichtete später: „Gegen 8 Uhr kam die Spitze des Zuges unter Vorantritt unserer SA-Kapelle auf dem Neupfarrplatz an. Unterbannführer Otto Metz konnte dem Bannführer der HJ, Karl Schäfer, 680 angetretene Hitlerjungen melden.“ Auch eine breite Beteiligung der Bevölkerung an der Bücherverbrennung auf dem Neupfarrplatz ist überliefert. Weiter berichtete die NS-Tageszeitung, dass nach Horst-Wessel-Lied und Ansprache „der Bannführer den Befehl gab, die marxistischen Bücher, Zeitschriften und Fahnen, die auf einem Handwagen mitgeführt wurden, zu verbrennen. Hellauf loderten die Flammen. [...]“.Man darf davon ausgehen, dass es sich bei den im Zeitungsbericht erwähnten „Fahnen“ um einige von der SA bereits am 9. März 1933 bei der Besetzung von örtlichen SPD-Einrichtungen erbeutete sogenannte Traditionsfahnen einzelner Parteigliederungen gehandelt hat.
Neben der Volkswacht-Buchhandlung war mindestens auch die von Albert Prasch geführte Bücher-Kiste von den Sammel- und Beschlagnahmungsaktionen im Vorfeld der Bücherverbrennung betroffen: Aufgrund der Warnung durch den Polizisten Lorenz Baier konnten viele Bände versteckt werden – Prasch schlug sie zum Teil in unverdächtige Umschläge ein, zum Beispiel von Grimms Märchen.
Auch Privatbestände nahmen Regimegegner ins Visier. Man weiß von Beschlagnahmungen beim damaligen SPD-Landtagsabgeordneten Alfons Bayerer (1885 bis 1940). Vier Mann, ein Zivilist und drei SA-Hilfspolizisten, transportierten etwa sieben bis acht Meter Bücher aus dem Privatbesitz des Politikers ab. Darunter nicht nur unliebsame politische Literatur, sondern auch als „undeutsch“ diffamierte Romane.
Es war aber kein Zufall, dass die NS-Bücherverbrennung auf dem Regensburger Neupfarrplatz stattfand – jenem Ort, dessen Geschichte die in der Domstadt aktiven Nationalsozialisten vehement zu verändern versuchten. Der Neupfarrplatz zählt nicht zu den „gewachsenen“ Plätze, sondern war 1519 durch einen gewaltsamen Eingriff in die Bausubstanz der Stadt bei einem Pogrom entstanden. Das damals dort gelegene jüdische Viertel, bis zu diesem Jahr Heimat einer der ältesten und bedeutendsten jüdischen Gemeinden Süddeutschlands, war dabei zerstört worden.
Heinrich Heines unheilvolle Prophezeiung aus dem Jahr 1823 sollte sich mehr als ein Jahrhundert später auf furchtbare Weise erfüllen. Zuerst brannten die Bücher, dann die Menschen. 1933 waren es „nur“ Bücher gewesen, die auf den Scheiterhaufen kamen – nicht einmal ein Jahrzehnt später waren es in den Krematorien der Vernichtungslager tatsächlich Menschen, die verbrannt wurden.
Auch sudetendeutsche Autoren betroffen
Der „öffentlichen Verbrennung von Schund- und Schmutzliteratur” fielen die Werke von Carl Zuckmayer, Heinrich und Thomas Mann, Berthold Brecht, Alfred Döblin und Kurt Tucholsky zum Opfer. Eine ganze Literatengeneration wurde mit Berufsverbot belegt und zur Flucht aus Deutschland gezwungen. „Neben den Mitgliedern des Prager Kreises wie Franz Kafka und Franz Werfel, deren Bücher von den Nazis als Aktion „gegen den undeutschen Geist“ verbrannt wurden, waren auch der sudetendeutsche Sozialdemokraten Josef Hofbauer und anderer sudetendeutscher Autoren betroffen. Die Ernst und Gisela Paul-Stiftung wird in den kommenden Wochen die von der Bücherverbrennung betroffenen sudetendeutschen Autoren recherchieren und veröffentlichen. „In den kommenden Jahren werden einzelne Werke neu aufgelegt bzw. einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht“, so der wegweisende Beschluss des Sitzungsvorstandes. „Es war ein Angriff auf die geistige Freiheit. Die Freiheit des Denkens und der Toleranz passte nicht in das nationalsozialistische Weltbild”, so die Vorstandsvorsitzenden der Ernst und Gisela Paul-Stiftung, Hans Tomani und Rainer Pasta.
Spendenaufruf